Aktuelle Aspekte, Best Practices und Tools
Warum technisches SEO weiterhin entscheidend ist: eine Übersicht.
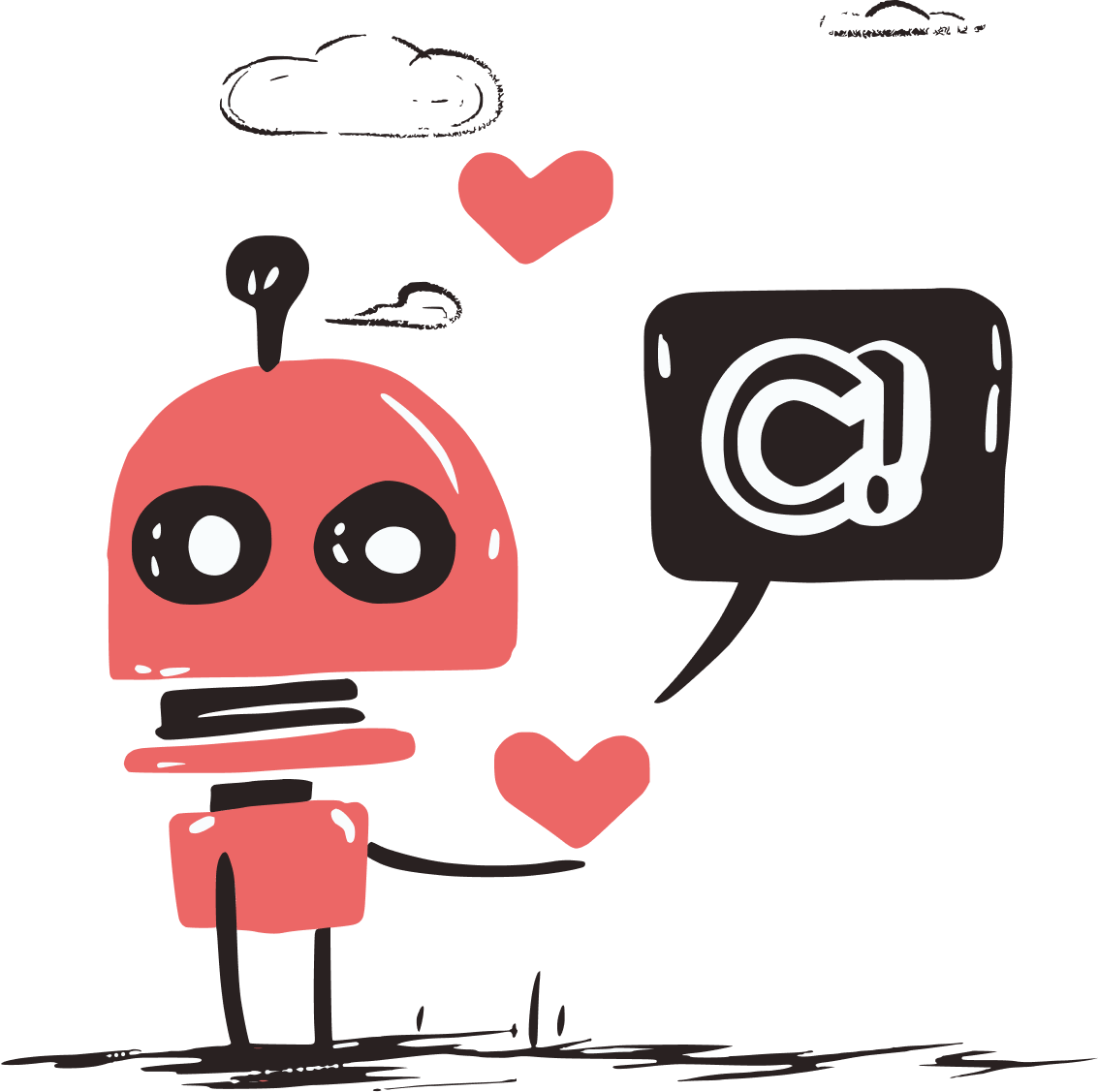
Was ist technisches SEO?
Technisches SEO bildet das Fundament für Online-Sichtbarkeit und darf 2025 keinesfalls vernachlässigt werden. Selbst mit KI und Machine Learning im Suchumfeld bleibt eine saubere technische Basis unerlässlich, damit Suchmaschinen Webseiten effizient crawlen, indexieren und verstehen können. Inhalte und Backlinks allein reichen nicht – erst wenn Crawler problemlos auf die Website-Struktur zugreifen und Nutzer eine schnelle, sichere Erfahrung haben, entfalten andere SEO-Maßnahmen ihre volle Wirkung. Kurz gesagt: Ohne technisches Fundament bleiben selbst die besten Inhalte unsichtbar.
Crawling und Indexierung optimieren
Ein zentrales Ziel im technischen SEO ist es, Crawling-Budget und Indexierung optimal zu nutzen. Google crawlt pro Website nur eine begrenzte Anzahl von URLs in bestimmter Zeit – dieses Crawl-Budget sollte nicht durch unnötige oder irrelevante Seiten verschwendet werden. Empfehlenswert ist:
Unnötige Seiten entfernen oder vom Crawling ausschließen:
Filter- und Suchergebnisseiten, veraltete Seiten, Testumgebungen etc. verursachen Crawl-Waste und gehören per robots.txt oder noindex ausgespart. Die Analyse von Server- oder Crawl-Logs hilft, solche Seiten zu identifizieren.
Saubere Website-Struktur:
Ein verbreiteter Mythos ist, dass eine „flache“ Seitenarchitektur immer besser sei. Stattdessen sollten Inhalte strukturiert und logisch in Kategorien oder Verzeichnissen organisiert werden. Klare hierarchische URLs (z. B. /produkte/jacken/herren) und sinnvolle Kategorieseiten geben Crawlern wie Nutzern Orientierung. Wichtige Inhalte sollten über interne Links in wenigen Klicks erreichbar sein (Faustregel: maximal 3 Klicks), um sicherzustellen, dass der Crawler nichts Wesentliches übersieht.
Weiterleitungen optimieren:
Vermeide lange Redirect-Ketten und unnötige Umleitungen. Jede Weiterleitung kostet Crawl-Budget und kann die Ladezeit erhöhen. Alte oder fehlerhafte URLs sollten per 301-Redirect möglichst direkt auf die Ziel-URL zeigen. Überprüfe regelmäßig die Redirect-Logik der Website und minimiere Zwischenschritte.
Duplicate Content managen:
Stelle mit kanonischen Tags (Canonical) sicher, dass bei mehrfach erreichbaren Inhalten nur die Haupt-URL indexiert wird. Das beugt Verwirrung im Index vor. Ebenso sollten ggf. hreflang-Tags bei mehrsprachigen Seiten gesetzt werden, damit jede Sprach-/Länderversion korrekt von Google zugeordnet wird.
Weitere wichtige Hilfsmittel für die Indexierungssteuerung sind XML-Sitemaps und die Google Search Console. Eine aktuelle Sitemap listet alle indexierbaren Seiten auf – diese Datei sollte in der Search Console hinterlegt werden, um Google über neue oder geänderte Inhalte zu informieren. In der Search Console selbst können Webmaster den Indexierungsstatus prüfen, Crawling-Fehler erkennen und einzelne URLs mit der URL-Prüfung inspizieren. So lässt sich schnell feststellen, ob wichtige Seiten erfolgreich gecrawlt und indexiert werden oder ob etwa robots.txt-Regeln, Noindex-Tags oder andere technische Probleme die Indexierung verhindern.
Seitenladezeit und Core Web Vitals
Page Speed ist ein kritischer Rankingfaktor und trägt massiv zur User Experience bei. Langsame Webseiten frustrieren Nutzer (hohe Absprungrate) und werden von Suchmaschinen schlechter bewertet. Moderne technische SEO legt daher großen Fokus auf die Optimierung der Ladezeiten und der Core Web Vitals:
Bilder optimieren:
Große, unkomprimierte Bilder gehören zu den Hauptverursachern langsamer Ladezeiten. Bilder sollten vor dem Upload komprimiert oder in effiziente Formate wie WebP konvertiert werden.
Browser-Caching nutzen:
Durch Caching können wiederkehrende Besucher statische Ressourcen (JS-/CSS-Dateien, Bilder) aus dem lokalen Cache laden. Eine entsprechende Konfiguration (z. B. per .htaccess oder CMS-Plugins) reduziert Ladezeiten erheblich.
Render-blockierende Ressourcen minimieren:
JavaScript- und CSS-Dateien, die das Rendering blockieren, sollten verkleinert, zusammengefasst oder verzögert geladen werden (Stichwort defer oder async). Viele CMS bieten dafür Optionen oder Plugins.
Performantes Hosting:
Der Webhoster beeinflusst die Server-Antwortzeiten. Für eine schnelle Auslieferung sind ausreichend Server-Ressourcen und ggf. ein CDN sinnvoll. Insbesondere bei Shared-Hosting sollte man auf garantierte Performance achten.
Core Web Vitals messen konkrete Aspekte der Ladeperformance und Interaktivität. Google bewertet hier vor allem: Largest Contentful Paint (LCP) für Ladezeit des Hauptinhalts, Interaction to Next Paint (INP) (seit 2024 als Ersatz für FID) für Responsiveness bei der ersten Nutzeraktion und Cumulative Layout Shift (CLS) für visuelle Stabilität. Diese Kennzahlen sollten im grünen Bereich liegen. Google Search Console zeigt im Core Web Vitals-Bericht, welche URLs Optimierungsbedarf haben. In der Regel decken sich empfohlene Maßnahmen mit allgemeinen Page-Speed-Optimierungen – beispielsweise LCP-Probleme durch Bild- und Server-Optimierung oder CLS-Probleme durch feste Größenangaben für Bilder/Elemente lösen.
Mobile-Optimierung als Standard
Da Google vollständig auf Mobile-First Indexing umgestellt hat, dient die mobile Version einer Website als primäre Grundlage für die Indexierung und Rankings. Eine exzellente mobile Darstellung ist somit Pflicht:
Responsive Design:
Das Layout muss sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen. Moderne Webseiten und CMS-Themes sind meist von Haus aus responsive, doch es lohnt ein prüfender Blick auf Darstellungsfehler.
Mobile Usability:
Navigation und Buttons sollten auf Touch-Geräten leicht bedienbar sein (ausreichende Größe und Abstände). Auch die Schrift sollte auf kleinen Screens gut lesbar sein.
Testing:
Das kostenlose Google Mobile-Friendly Test Tool ermöglicht eine schnelle Prüfung, ob Google die Seite als mobilfreundlich einstuft. Hier erhält man zudem Hinweise auf Verbesserungen.
Page Speed mobil:
Da mobile Nutzer oft langsamere Verbindungen haben, wiegen Performance-Probleme hier doppelt. Die bereits erwähnten Speed-Optimierungen sind daher gerade für Mobile essenziell.
Fehlerhafte mobile Umsetzung (etwa verdeckte Inhalte, nicht ladende Elemente oder unhandliche Bedienung) schadet nicht nur der User Experience, sondern direkt den Rankings im mobilen Index. Technisches SEO muss also mobile und Desktop gleichermaßen im Blick behalten, mit Priorität auf einem reibungslosen mobilen Erlebnis.
Sicherheit und Seitenzugänglichkeit
HTTPS-Verschlüsselung ist heute Standard und wird von Suchmaschinen auch als Rankingsignal gewertet. Jede Website sollte ein gültiges SSL-Zertifikat haben und alle Aufrufe konsequent per HTTPS bereitstellen. Das Umstellen ist dank Let’s Encrypt und Hosting-Tools meist unkompliziert; anschließend müssen automatische Weiterleitungen von HTTP auf HTTPS eingerichtet und interne Links angepasst werden. Browser kennzeichnen ungesicherte Seiten als unsicher – für Nutzervertrauen und SEO ist das ein No-Go.
Ebenfalls Teil der technischen Hygiene ist der korrekte Umgang mit Weiterleitungen und Statuscodes: Wenn URLs sich ändern (z. B. nach einem Relaunch), sind 301-Redirects Pflicht, um alte Rankings und Verlinkungen auf die neuen URLs zu übertragen. Fehlende oder falsche Redirects führen zu 404-Fehlern, was Nutzer und Crawler in Sackgassen schickt. In einem regelmäßigen SEO-Audit sollten daher Broken Links und HTTP-Statuscodes geprüft und behoben werden. Die Google Search Console hilft, Not Found-Seiten aufzuspüren.
Strukturierte Daten für bessere Verständlichkeit
Strukturierte Daten (Schema Markups) helfen Suchmaschinen, die Inhalte einer Seite semantisch einzuordnen. Durch Markup in Form von z. B. JSON-LD kann man definieren, was eine Seite enthält – ob es sich um ein Produkt mit Preis und Bewertung handelt, einen Artikel mit Autor und Datum, ein lokales Unternehmen mit Adresse, FAQs, Events u.v.m.. Der Nutzen ist zweifach: Zum einen können Suchmaschinen Informationen effizienter und präziser verarbeiten. Zum anderen ermöglichen bestimmte Markups Rich Results (erweiterte Snippet-Darstellungen wie Sterne-Bewertungen, FAQ-Dropdowns, Rezeptbilder etc.), was die Sichtbarkeit in der Trefferliste steigert.
John Mueller von Google betont, dass strukturierte Daten auch im Zeitalter der AI-Suchergebnisse wichtig bleiben – sie liefern klar formatierte Fakten und erleichtern Bots das Auslesen. Seitenbetreiber sollten sich auf die Schema-Typen fokussieren, die tatsächlich in den Suchergebnissen genutzt werden (eine aktuelle Übersicht listet gängige Markups und ihre SERP-Auswirkungen).
Die Implementierung ist dank zahlreicher Generator-Tools und CMS-Plugins (etwa für WordPress: Yoast, RankMath, Schema Pro etc.) auch ohne Programmierung möglich. Nach dem Einbau sollte man mit dem Google Rich Results Test überprüfen, ob die Daten korrekt erkannt werden. Für lokale Unternehmen lohnt sich insbesondere das LocalBusiness-Markup, um Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details in Google hervorzuheben.
JavaScript und Rendering beachten
Moderne Websites nutzen oft JavaScript für interaktive Inhalte – doch aus SEO-Sicht gilt es vorsichtig zu sein, wie viele kritische Inhalte ausschließlich clientseitig nachgeladen werden. Googlebot kann mittlerweile JavaScript rendern, aber nur verzögert und mit Aufwand. Viele KI-basierte Crawler (LLMs) sind hingegen aktuell nicht in der Lage, JS auszuführen. Daher sind folgende Best Practices sinnvoll:
Wichtige Inhalte serverseitig rendern:
Alle zentralen Inhalte (Texte, Produktinfos, Navigation, interne Links) sollten im initialen HTML-Code vorhanden sein. Inhalte, die erst per JS erscheinen, könnten von Crawlern übersehen werden. Falls eine Web-App viel clientseitig rendert, kann Dynamic Rendering oder eine hybride Lösung helfen (für Crawler eine vorgerenderte Version ausspielen).
Keine Links und Navigation verstecken:
Menülinks oder Verknüpfungen, die nur via Klick auf JS-Elemente sichtbar werden, sind problematisch. Interne Links sollten möglichst im HTML verankert sein, da sonst weder Google noch LLM-Crawler sie zuverlässig erfassen. Ein Beispiel: Accordion- oder Tab-Inhalte – achte darauf, dass wichtige Abschnitte nicht komplett eingeklappt bleiben.
Polyfill für fehlende Rendering-Fähigkeit der KI-Bots:
Da ChatGPT-User, PerplexityBot & Co. derzeit kein JS ausführen, müssen Seitenbetreiber Lösungen finden, damit solche Bots Inhalte dennoch „sehen“ können. Zwei pragmatische Ansätze aus der Praxis sind: (a) Separate Landingpages nur für KI-Crawler anlegen, die alle wesentlichen Infos im reinem HTML bereitstellen (ggf. auf einer speziellen Subdomain). Diese Seiten kann man mittels robots.txt gezielt für KI-Bots freigeben, ohne sie im normalen Index prominent zu machen. (b) Strukturierte Daten gezielt erweitern: Interessanterweise konnten einige KI-Crawler in Tests JSON-Daten und ähnliche eingebettete Inhalte auslesen. Wichtigste Inhalte zusätzlich als strukturierte Daten (z. B. FAQ, HowTo) im Quellcode bereitzustellen, stellt sicher, dass LLMs diese Informationen extrahieren können.
Zum Debuggen von Rendering-Problemen eignet sich die Chrome-Extension View Rendered Source, um Original-HTML vs. gerendertes DOM zu vergleichen. So erkennt man, ob und welche Inhalte nur via JavaScript nachgeladen werden. Im Zweifel gilt: „Progressive Enhancement“ – erst die Grundinhalte statisch ausliefern, zusätzliche Features dann per JS. So ist die Seite sowohl für Nutzer als auch für alle Crawler zugänglich.
Steuerung von Crawlern über robots.txt
Die Datei robots.txt bleibt ein wichtiges Steuerungsinstrument, um Crawler zu lenken. Hier einige aktuelle Empfehlungen:
- Allow Important Bots, Block Unnecessary Ones:
By default, robots.txt should permit all major search engine bots (User-agent: *) to crawl all public areas while excluding unimportant or sensitive sections (admin panels, login pages, shopping carts, etc.). This focuses crawling efforts on relevant content. - Specifically Handle AI Crawlers:
In 2025, new bots from AI services are emerging. OpenAI and Microsoft, for example, utilize their own crawlers (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Bing Chat via PerplexityBot, etc.), and Google has introduced the Google-Extended agent for AI functions. It's advisable to update the robots.txt file to include rules for these bots. A proven practice is allowing crawling for AI search bots while excluding AI training bots. Specifically: allow bots like OAI-SearchBot, ChatGPT-User, or PerplexityBot with Allow: /, while disallowing bots like GPTBot (OpenAI’s training bot), CCBot (Common Crawl), and Google-Extended via Disallow: /. This approach lets AI systems access current site information without content being integrated into long-term training data. - Caution with Google-Extended:
Google uses this user-agent to improve generative AI features (e.g., SGE). Blocking Google-Extended via robots.txt prevents your content from being used in AI responses but risks exclusion from AI Overviews. Decide carefully whether visibility in Google’s AI results is desired—in doubt, consider removing this entry to avoid losing visibility. - Avoid Unintentional Blockades:
Regularly audit the robots.txt to ensure no bots or directories are inadvertently blocked. Some webmasters mistakenly used rules like User-agent: OpenAI-GPT or Google-Extended: Disallow /, unintentionally preventing all AI bot access. Regular checks avoid unintended content invisibility.
The idea of a specialized llm.txt file for AI crawlers is also discussed, but according to Google, there’s currently no evidence that AI search systems use such a file. Thus, prioritize proven methods (robots.txt, meta tags).
(Tip: Use tools like TechnicalSEO's Robots Tester to validate your robots.txt file—many AI user-agents are already listed, allowing preemptive rule checks.)
Technische SEO-Aspekte für KI-Suche (LLM-Optimierung)
Die wachsende Verbreitung von Large Language Models und KI-Suchassistenten (ChatGPT, Bing Chat, Perplexity, Google SGE etc.) hat neue Facetten ins technische SEO gebracht. Auch wenn der Traffic-Anteil dieser KI-Tools im Moment noch gering ist (oft deutlich <1 % des Gesamttraffics), nimmt er stetig zu. Wer zukunftsorientiert arbeitet, beachtet daher folgende Punkte:
Indexierbarkeit = Sichtbarkeit in KI:
Inhalte, die nicht indexiert sind, erscheinen weder in klassischen SERPs noch in AI-Overviews. LLM-basierte Systeme wie Googles AI Overviews greifen auf den vorhandenen Suchindex zurück. Entsprechend bleiben klassische Crawl- und Indexierungsoptimierungen (siehe oben) die Grundvoraussetzung, um überhaupt in KI-Antworten stattzufinden. Google Bard bzw. Gemini zitiert beispielsweise nur Inhalte, die vom Googlebot gecrawlt und verstanden wurden. Technisches SEO ist daher auch die Basis der KI-Optimierung.
Server-seitige Inhalte für KI-Crawler:
Da KI-Crawler JavaScript (noch) nicht rendern können, müssen relevante Inhalte für diese Bots direkt im HTML vorhanden sein. (Dieses Thema wurde im Abschnitt JavaScript und Rendering bereits erläutert.) JS-only Content vermeiden – das betonen mehrere Experten explizit.
Strukturierte Daten und klare Formate nutzen:
Weil LLMs strukturierte, wohldefinierte Informationen bevorzugen, kommen klassische SEO-Taktiken wie FAQ-Abschnitte oder übersichtliche Tabellen und Listen wieder zum Tragen. Häufig gestellte Fragen plus prägnante Antworten auf der Website helfen nicht nur in PAA-Snippets, sondern auch KI-Systemen, den Content auszulesen. Ebenso tragen strukturierte Daten (wie oben erwähnt) dazu bei, dass maschinelle Systeme Inhalte effizient erfassen. Google rät z. B. zur Nutzung von JSON-LD, da es für AI-Crawler am leichtesten zu parsen ist.
Inhaltliche Themenabdeckung statt Keyword-Fokus:
Für KI-generierte Antworten zählt thematische Autorität. Statt einzelne Keywords zu jagen, empfiehlt es sich, ein Thema in seiner gesamten Breite abzudecken (Topical Authority). Größere, gut strukturierte Leitfäden oder Cluster aus verknüpften Beiträgen signalisieren den Modellen umfassendes Wissen. Erste Analysen zeigen, dass LLMs ausführliche, klar gegliederte Inhalte bevorzugt zitieren – Qualität und Tiefgang schlagen oberflächliche Texte.
Digital PR und Erwähnungen:
Backlinks bleiben wichtig, aber bei KI-Antworten zählen insbesondere Marken-Erwähnungen in vertrauenswürdigen Quellen. KI-Systeme ziehen bei komplexen Fragen gern Drittquellen heran. Wenn z. B. ein AI Overview nach der „besten Online-Marketing-Agentur“ gefragt wird, stammen die Antworten oft aus Artikeln oder Listen, die solche Agenturen erwähnen – nicht unbedingt von deren eigenen Websites. Online-Reputation und Präsenz in Fachmedien, Foren (z. B. hilfreiche Antworten in Q&A-Communities) und Branchenverzeichnissen stärken somit die Chance, dass die eigene Marke in KI-Ergebnissen auftaucht. Digital PR gewinnt eher noch an Bedeutung.
Monitoring und Messung von KI-Traffic:
Derzeit ist das Tracking von KI-vermitteltem Traffic noch herausfordernd. Tools wie Google Analytics erkennen Besuche von ChatGPT, Bing Chat oder Perplexity aber als Referrals, z. B. bing.com/chat oder chat.openai.com tauchen in den Referrer-Daten auf. In GA4 lassen sich mittels Segmenten und Regex-Filter solche Referrals herausfiltern, um zu sehen, welche Seiten von KI-Besuchern angesteuert werden. (Beispielsweise ein Regex auf ^(copilot\.microsoft\.com|perplexity\.ai|chatgpt\.com)/referral$ bündelt entsprechende Zugriffe.) Darüber hinaus bringen SEO-Tools neue Funktionen: Semrush bietet seit Ende 2024 ein AI-Overview-Tracking, und SERanking hat 2025 einen AI Overview Tracker lanciert. Spezialisierte Dienste wie Trackerly.ai, Peec.ai, BrandMonitor für LLM etc. analysieren zudem, wie oft eine Marke in KI-Ergebnissen genannt wird. Hier entwickelt sich ein neues Monitoring-Feld – für den Anfang tut es aber auch ein manueller Check: Etwa ChatGPT direkt fragen, „Was weißt du über [meine Marke]?“, um einen Eindruck der KI-Sichtbarkeit zu bekommen.
Unterm Strich unterscheiden sich Best Practices für LLM-SEO gar nicht so stark von klassischer SEO. Vielmehr bauen sie darauf auf: Eine starke technische Basis, hochwertiger Content und Vertrauenssignale (Autorität) sind weiterhin der Schlüssel. KI-Optimierung bedeutet also keine völlige Abkehr von bekannten SEO-Prinzipien, sondern deren bewusste Erweiterung und Priorisierung für neue Suchumgebungen.
Nützliche Tools und praktische Tipps
Die Umsetzung von technischem SEO wird durch zahlreiche Tools erleichtert. Hier eine Auswahl empfehlenswerter Helfer und Best Practices:
Google Search Console (GSC):
Unverzichtbar und kostenlos. GSC liefert Einblicke in Indexierungsstatus, Crawling-Probleme, Core Web Vitals-Auswertung, Mobil-Friendly-Tests und erkannte strukturierte Daten. Regelmäßiger Blick in GSC ermöglicht es, technische Fehler früh zu erkennen – z. B. Seiten, die aus dem Index gefallen sind, Crawler-Fehler (DNS, Serverfehler, Blockierungen) oder Seiten mit schlechten Nutzerparametern.
PageSpeed Tools:
Google PageSpeed Insights und GTmetrix analysieren die Ladegeschwindigkeit und geben konkrete Optimierungsvorschläge. Auch Lighthouse (im Chrome-Browser) oder WebPageTest.org sind nützlich, um Flaschenhälse bei der Performance zu finden. Über diese Tools erfährt man etwa, welche Skripte am meisten Renderzeit kosten oder welche Bilder zu groß sind.
Mobile Testing:
Neben GSC’s Mobile Usability Report bietet der eigenständige Mobile-Friendly Test schnelle Gewissheit über die mobile Darstellungsqualität. Hierauf sollte man jede wichtige Seite prüfen, insbesondere nach größeren Design- oder Template-Änderungen.
Crawler und Audits:
- Ein Desktop-Crawler wie Screaming Frog SEO Spider (bis 500 URLs in der Gratisversion) simuliert das Crawling der Website und deckt technische SEO-Probleme auf – z. B. 404-Fehlerseiten, lange Redirect-Ketten, fehlende oder doppelte Titel und Meta-Descriptions, sehr große Seitengrößen, etc.. Solche Tools erlauben einen schnellen Site Audit auf technischer Ebene. Pro-Tipp: Screaming Frog lässt sich via API sogar mit ChatGPT koppeln, um z.B. automatisiert Content-Verbesserungsvorschläge je gecrawlter Seite zu erhalten.
Weitere hilfreiche Tools:
- Google Rich Results Test (Prüfung von strukturierten Daten)
- XML-Sitemaps.com Generator (falls das CMS keine Sitemap liefert)
- TechnicalSEO.com Robots Tester (zum Validieren der robots.txt-Regeln, inkl. KI-Bots)
- Browser-Extensions wie View Rendered Source (für JS-Check) oder SEO Minion (zeigt u.a. hreflang-Verknüpfungen, Broken Links auf der Seite etc.)
- Logfile-Analyzer (optional für größere Sites, um Googlebot’s Crawlpfad genau nachzuvollziehen)
Checklisten & Prozesse:
Arbeiten Sie am besten mit einer SEO-Checkliste oder einem definierten Audit-Prozess, um alle Bereiche abzudecken. Eine mögliche DIY-Prüfroutine könnte so aussehen:
- GSC-Daten sichten (Indexierungsreport, Core Web Vitals, Mobil, Verbesserungen);
- Website mit Crawler scannen und Probleme sammeln (404, Redirects, Duplicate Content, fehlende Tags);
- Ladezeiten der wichtigsten Seiten messen;
- Mobiltests durchführen;
- HTTPS und Zertifikat prüfen (keine Mixed-Content-Warnungen);
- Sitemap und robots.txt kontrollieren;
- Strukturierte Daten testen;
- Ergebnisse dokumentieren und priorisieren. So eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise stellt sicher, dass nichts Wesentliches übersehen wird und die wichtigsten To-Dos identifiziert sind. Priorisierung ist entscheidend – zuerst kritische Fehler beheben (z.B. Indexierungsblockaden, gravierende Speed-Probleme), dann „Nice-to-haves“ optimieren.
Abschließend noch ein Hinweis aus der Praxis: Technisches SEO ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Änderungen am Website-Code, neue Features, Inhalte oder Google-Updates können jederzeit technische Anpassungen nötig machen. Mit einem Mix aus automatisiertem Monitoring (Alerts aus GSC, regelmäßige Crawls) und manueller Überprüfung behält man die technische Gesundheit der Website im Griff.

Fazit: Modernes technisches SEO 2025 verlangt einerseits die etablierten Grundlagen – schnelle Ladezeiten, saubere Struktur, Fehlerfreiheit – und andererseits die Aufmerksamkeit für neue Entwicklungen wie die Einbindung von KI-gestützten Suchfunktionen.
Die gute Nachricht: Wer bereits bewährte SEO-Praktiken verfolgt, muss sein Handwerkszeug nicht komplett neu erfinden. Vielmehr geht es darum, diese Best Practices konsequent umzusetzen und an ein paar Stellen zu erweitern. Die klare Struktur und Zugänglichkeit der Website bildet die Basis für alle SEO-Kanäle. Darauf aufbauend kann man mit hochwertigem Content und gezielter Optimierung sicherstellen, sowohl im organischen Ranking als auch in AI-Ergebnissen sichtbar zu sein. Technisches SEO bleibt somit – trotz aller Veränderungen durch KI – der unverzichtbare Grundpfeiler einer erfolgreichen Suchstrategie.
mit einem kostenfreien Strategiegespräch!