Audit & Bestandsanalyse
Barrierefreiheit prüfen und den Ist-Zustand analysieren.

Was ist ein Accessibility-Audit?
Ein Accessibility-Audit (auch Barrierefreiheits-Prüfung oder Bestandsanalyse der Barrierefreiheit) ist eine systematische Überprüfung einer Website oder App auf Einhaltung anerkannter Zugänglichkeitsstandards wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Ziel eines solchen Audits ist es, alle Barrieren zu identifizieren, die Menschen mit Behinderungen daran hindern könnten, die digitalen Inhalte oder Funktionen uneingeschränkt zu nutzen. Dabei werden verschiedenste Aspekte der Website untersucht – vom Design und Code bis zur Benutzerführung – um Schwachstellen aufzudecken, an denen Nutzerinnen mit Einschränkungen auf Probleme stoßen. Ein Accessibility-Audit dient als Grundlage, um diese Schwachstellen gezielt zu beheben und sicherzustellen, dass möglichst viele Nutzerinnen – unabhängig von ihren physischen oder kognitiven Fähigkeiten – effektiv auf die Website zugreifen können.
Hauptbestandteile eines Audits: Bei einer professionellen Zugänglichkeitsprüfung kommen sowohl automatisierte Tests als auch manuelle Prüfungen zum Einsatz. Automatisierte Tools können z. B. den Quellcode auf WCAG-Konformität scannen und Hinweise auf typische Fehler geben (etwa fehlende Alternativtexte oder Farbkontraste). Die manuellen Tests durch Expert*innen sind jedoch unerlässlich, um kontextbezogene Probleme aufzudecken und die tatsächliche Nutzererfahrung – etwa mit Screenreadern oder nur per Tastatur-Navigation – zu bewerten. Geprüft wird typischerweise eine repräsentative Auswahl an Seiten und Funktionen der Website (der Prüfumfang sollte methodisch nachvollziehbar und relevant gewählt werden). Ein Audit umfasst alle vier Prinzipien der Barrierefreiheit (Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit, Robustheit) und deckt Themen ab wie semantisches HTML, korrekte Formular-Beschriftungen, Navigationsstruktur, Medien-Alternativen, Fehlerbehandlung und technische Kompatibilität mit Hilfstechnologien. Kurz gesagt: Ein Accessibility-Audit schaut sich alles an, was dafür sorgt, dass alle Nutzer unabhängig von Behinderungen effizient navigieren und interagieren können.
Warum sollte man eine Bestandsanalyse der Barrierefreiheit durchführen?
Ein Audit des aktuellen Stands der Barrierefreiheit ist aus mehreren Gründen sinnvoll – es ist mehr als nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine Chance für Ihre Website und Ihr Unternehmen:
Rechtliche Konformität sicherstellen:
In vielen Ländern – so auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz – treten ab 2025 strengere Gesetze zur digitalen Barrierefreiheit in Kraft. Insbesondere verpflichtet das deutsche Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ab dem 28. Juni 2025 zahlreiche private Unternehmen, ihre Websites und mobilen Anwendungen barrierefrei anzubieten. Wer z. B. im B2C-Bereich Online-Dienstleistungen oder E-Commerce anbietet und bestimmte Mitarbeiter- oder Umsatzschwellen überschreitet, muss dann die Anforderungen der europäischen Norm EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) erfüllen. Bei Verstößen drohen empfindliche Konsequenzen – von Abmahnungen und Schadensersatzforderungen bis zu Bußgeldern von bis zu 100.000 € oder sogar der Untersagung des Online-Angebots. Ein Audit hilft, rechtzeitig alle nötigen Maßnahmen zur Compliance zu ergreifen, um solche rechtlichen und finanziellen Risiken zu vermeiden. (Details zu den gesetzlichen Pflichten finden Sie auf unserer Seite „Fristen & Pflichten“.)
Inklusion und Vermeidung von Diskriminierung:
Ein barrierefreier Webauftritt ermöglicht Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Services. Dies fördert die soziale Teilhabe und verhindert die Ausgrenzung einer erheblichen Bevölkerungsgruppe. Rund 15 % der Weltbevölkerung lebt mit irgendeiner Form von Behinderung – in Deutschland sind ca. 8 Millionen Menschen (9 % der Bevölkerung) schwerbehindert. Indem Sie Barrieren beseitigen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Inklusion dieser Menschen. Ein Audit deckt dabei systematisch auf, wo Ihre Website aktuell noch diskriminierende Hürden hat, und ebnet den Weg, diese abzubauen.
Größere Reichweite & neue Zielgruppen:
Barrierefreiheit zahlt sich auch in Form von mehr Nutzern und Kundinnen aus. Ein zugänglicher Webauftritt spricht eine enorm große potenzielle Kundengruppe zusätzlich an. Menschen mit Behinderungen – weltweit über 1 Milliarde – und ihre Angehörigen verfügen über erhebliche Kaufkraft. Studien zeigen, dass über 70 % der Betroffenen Websites verlassen, die ihre Anforderungen nicht erfüllen. Durch einen barrierefreien Auftritt können Sie also verhindern, dass Ihnen dieser Kundenanteil verloren geht, und Ihr Marktpotenzial erhöhen. Außerdem profitieren auch Menschen ohne dauerhafte Behinderung davon: Zum Beispiel ältere Nutzerinnen mit nachlassendem Seh- oder Hörvermögen oder Personen mit situativen Einschränkungen (etwa temporär verletzte oder in lauter Umgebung) schätzen barrierefreie Websites.
Verbesserte User Experience für alle:
Maßnahmen aus einem Accessibility-Audit führen oft zu allgemeinen Usability-Verbesserungen. Klar strukturierte Inhalte, gute Lesbarkeit, verständliche Formulare und eine intuitive Navigation kommen allen Anwendern zugute. Insbesondere vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Internetnutzerschaft ist Barrierefreiheit gleichbedeutend mit besserer Bedienbarkeit und Kundenzufriedenheit in breiten Bevölkerungsschichten. Kurz: Eine barrierefreie Website bietet insgesamt ein besseres Nutzererlebnis, was sich in längeren Verweildauern und höherer Konversionsrate niederschlagen kann.
Stärkung von Markenimage und Vertrauen:
Proaktives Engagement für Barrierefreiheit verbessert den Ruf eines Unternehmens. Es zeigt, dass Sie soziale Verantwortung (CSR) ernst nehmen und alle Kundengruppen wertschätzen. Unternehmen, die frühzeitig in digitale Inklusion investieren, werden als fortschrittlich und werteorientiert wahrgenommen – ein Wettbewerbsvorteil in puncto Image. Ein positives Markenimage fördert wiederum die Kundenloyalität. Kunden, die auf einer barrierefreien Website ein nahtloses Erlebnis haben, kommen eher wieder und bleiben Ihrer Marke treu.
SEO und technische Vorteile:
Viele Accessibility-Best-Practices (semantische HTML-Strukturen, Alt-Texte, saubere Überschriftenhierarchien, etc.) erleichtern zugleich Suchmaschinen das Crawlen und Interpretieren Ihrer Seiten. Suchmaschinen belohnen nutzerfreundliche, gut strukturierte Websites – barrierefreie Seiten ranken daher oft besser in den Suchergebnissen. Eine Studie bezifferte den möglichen Anstieg organischen Traffics durch Barrierefreiheit auf bis zu 50 %. Zudem reduziert ein zugängliches, standardkonformes Webangebot meist die technischen Schulden und ist zukunftssicherer gegenüber neuen Geräten oder Browsern.

Fazit:
Ein Accessibility-Audit als Bestandsaufnahme bietet nicht nur die Chance, gesetzlichen Pflichten stressfrei nachzukommen, sondern bringt handfeste geschäftliche Vorteile. Es erweitert Ihre Reichweite, verbessert das Nutzungserlebnis und stärkt Ihre Marke. Kurz gesagt: Barrierefreiheit ist kein lästiger Mehraufwand, sondern ein Qualitätsmerkmal, das sich auf vielfältige Weise bezahlt macht.
Wie läuft ein Accessibility-Audit ab?
Viele Anbieter führen Accessibility-Audits durch – mit teils erheblichen Unterschieden in Tiefe, Methode und Ergebnisqualität. Bei InboundLabs folgt der Audit einem klar definierten Prüfkonzept, das sowohl automatisierte Tools als auch manuelle Prüfverfahren, Nutzertests mit Assistenztechnologien und einen Device-übergreifenden Check umfasst. Der gesamte Ablauf ist dabei so konzipiert, dass er sich gemeinhin in 1-3 Werktagen (reine Arbeitszeit) realisieren lässt, sofern es sich um eine typische Website mittlerer Komplexität handelt (z. B. Corporate Site mit wiederverwendbaren Templates). Bei größeren oder technisch besonders anspruchsvollen Auftritten erfolgt die Prüfung modular oder in Etappen. Ziel ist immer, schnellstmöglich eine belastbare Ist-Analyse zu liefern – kein Tool-Report, sondern eine echte Entscheidungsgrundlage.
Ein professionelles Audit folgt einem klar strukturierten Ablauf, den erfahrene Agenturen oder Prüfer meistens ähnlich handhaben. In der Regel umfasst der Prozess folgende Schritte:
1. Definition von Zielen und Prüfumfang:
Zu Beginn wird festgelegt, welche Bereiche der Website geprüft werden sollen und welche Ziele Sie mit dem Audit verfolgen. Wichtig ist eine sinnvolle Auswahl repräsentativer Seiten, Funktionen und Inhalte – je nach Größe der Website oft eine Stichprobe, die alle Seitentypen abdeckt. Die Auswahl darf nicht willkürlich sein, sondern sollte methodisch begründet und zur Zielanwendung passend erfolgen. In dieser Phase wird auch geklärt, ob bestimmte gesetzliche Vorgaben (z. B. WCAG 2.1 AA nach BFSG) im Fokus stehen.
2. Automatisierter Testlauf:
Nun kommt der Einsatz von Prüf-Tools. Mit speziellen Accessibility-Scannern wird die Website automatisiert analysiert (ähnlich einem SEO-Crawl, aber mit Barrierefreiheits-Regeln). Diese Tools – z. B. Axe, Wave, der BITV-Test Prüfassistent oder auch Lösungen wie SiteCockpit easyMonitoring – melden HTML- und CSS-Probleme, die auf Barrieren hindeuten (fehlende Alternativtexte, falsche Überschriftenhierarchie, Formfeld ohne Label, etc.). Ein automatisierter Test kann viele einfache Fehler in kurzer Zeit finden. Allerdings deckt er bei Weitem nicht alles ab: Nur etwa 30–40 % der WCAG-Kriterien lassen sich voll automatisiert prüfen. Deshalb ist dieser Schritt nur der Auftakt.
Bei InboundLabs kommen dabei standardisierte Tools wie Axe, WAVE oder Lighthouse zum Einsatz. Zusätzlich nutzen wir eine eigene, dokumentierte Prüfstrecke, um Ergebnisse zu validieren und doppelte Fehlerkennungen zu vermeiden. Anders als viele „Audit-Scanner“, die rein auf Tool-Ergebnisse setzen, ist dieser Schritt nur der Auftakt – nie der Endpunkt.
3. Manuelle Experten-Prüfung:
Anschließend durchforsten erfahrene Auditor*innen die ausgewählten Seiten manuell und deutlich gründlicher. Sie validieren die Ergebnisse der Tools und untersuchen vor allem all jene Kriterien, die nur mit menschlichem Urteil beurteilbar sind (z. B. Ist der Linktext aussagekräftig? Ist eine Beschreibung wirklich verständlich? Sind die Interaktionen auch nur mit der Tastatur oder per Screenreader sinnvoll nutzbar?). Experten prüfen die Website in der Praxis, oft mit Hilfe von Hilfstechnologien: Ein gängiges Vorgehen ist etwa, wichtige Seiten mit einem Screenreader (wie JAWS, NVDA oder VoiceOver) testweise zu bedienen und auf Barrieren zu stoßen. Auch die Tastaturnavigation wird geprüft: Lassen sich alle interaktiven Elemente ohne Maus erreichen? Gibt es sichtbare Fokus-Markierungen? Ebenso fließt die Bewertung echter Nutzerfreundlichkeit ein – z. B. ob Inhalte klar verständlich gegliedert sind und Fehlermeldungen bei Formularen sinnvoll formuliert wurden. Diese manuelle Tiefenanalyse deckt auch „versteckte“ Barrieren auf, die reine Tools nicht melden, und berücksichtigt reale Nutzungsszenarien (z. B. die Nutzung mit Vergrößerungssoftware oder Sprachausgabe). Dabei gilt: Vier-Augen-Prinzip erhöht die Qualität – manche Prüfstellen (wie der offizielle BITV-Test) lassen Ergebnisse von einem zweiten Prüfer verifizieren, um subjektive Unterschiede auszugleichen.
Ergänzend werden bei InboundLabs echte Nutzungsszenarien durchgespielt – etwa das Ausfüllen eines Kontaktformulars mit dem Screenreader NVDA oder die Navigation per Tastatur durch ein mehrstufiges Dropdown-Menü. Die manuelle Prüfung basiert auf einem strukturierten Kriterienraster und wird durch erfahrene Accessibility-Spezialist:innen durchgeführt. Für ausgewählte Sites erfolgt zusätzlich ein Responsive-Design-Check (Mobil- und Tablet-Ansicht) sowie eine Dokumentenprüfung: Hier werden z. B. eingebundene PDFs auf Maschinenlesbarkeit, korrekte Tag-Struktur und semantische Auszeichnung überprüft (nach PDF/UA-Kriterien). So entstehen valide Aussagen nicht nur über die Seite selbst, sondern auch über herunterladbare Inhalte – ein Punkt, der oft übersehen wird.
4. Besprechung der Ergebnisse:
Nachdem die Prüfungen abgeschlossen sind, erhalten Sie einen ersten Überblick über die gefundenen Probleme. Seriöse Anbieter gehen die wichtigsten Befunde zunächst mündlich oder in einem Meeting mit Ihnen durch, um Kontext zu geben. Oft werden dabei schon Prioritäten besprochen – welche Barrieren sind kritisch und müssen sofort behoben werden, welche haben geringere Auswirkungen? Dieses Briefing stellt sicher, dass alle Beteiligten das Ergebnis verstehen, bevor es in die Dokumentation geht.
5. Erstellung des Audit-Berichts:
Das Kernstück des Audits ist die Dokumentation aller Ergebnisse in einem umfassenden Bericht. Dieser Audit-Report wird schriftlich ausgearbeitet, enthält eine verständliche Zusammenfassung sowie eine detaillierte Mängelliste mit konkreten Befunden und Empfehlungen. (Details zum Bericht siehe unten.) In dieser Phase werden auch Maßnahmenvorschläge formuliert, wie man die identifizierten Barrieren beheben kann. Bei manchen Anbietern erhält man zusätzlich zum Fließtextbericht auch eine tabellarische Auflistung aller gefundenen Probleme (z. B. als Excel/CSV), um der Entwicklungsabteilung die Abarbeitung zu erleichtern. Wichtig: Der Audit-Bericht selbst sollte in einem barrierefreien Format bereitgestellt werden (z. B. als PDF/UA-Dokument oder als HTML-Version), damit er auch für Menschen mit Behinderung zugänglich ist.
Der Bericht umfasst eine Executive Summary, eine tabellarisch wie textlich aufgebaute Mängelliste mit WCAG-Referenz, sowie einen priorisierten Maßnahmenkatalog, der von der Technikabteilung direkt umgesetzt werden kann. Zusätzlich erhalten Kunden von InboundLabs einen kompakten Leitfaden mit Best Practices, der dabei hilft, Barrierefreiheit auch nach dem Audit im Tagesgeschäft mitzudenken – etwa bei neuen Seiten, Formularen oder Content-Elementen. Für alle Sites, die unter das BFSG oder vergleichbare Gesetze fallen, wird eine barrierefreie Vorlage für die gesetzlich geforderte „Erklärung zur Barrierefreiheit“ mitgeliefert.
6. Übergabe und Erläuterung:
Sobald der Bericht fertig ist, wird er Ihnen übergeben und erläutert. Oft gibt es eine Abschlusspräsentation oder zumindest ein Gespräch, in dem offene Fragen geklärt werden. Schließlich soll das Audit ein klares Bild vermitteln: Welche Teile Ihrer Website sind bereits barrierefrei und wo besteht konkreter Handlungsbedarf. Idealerweise priorisiert der Bericht die notwendigen Änderungen nach Dringlichkeit, sodass Sie einen klaren Fahrplan für die Umsetzung haben.
7. Optional: Quick-Check vorab:
Einige Agenturen (z. B. netspirits) bieten vor dem ausführlichen Audit einen kostenlosen Quick-Check an – quasi eine kleine Voranalyse, die die größten Barrieren aufdeckt. Das kann sinnvoll sein, um einen Eindruck vom Umfang der Probleme zu erhalten. Ein solcher Schnelltest (oft eine Mischung aus automatisiertem Scan und stichprobenartigem manuellen Check) ersetzt jedoch keinen vollständigen Audit, gibt aber einen guten Einstieg und hilft bei der Planung des großen Audits. Auch mit frei verfügbaren Tools können Sie selbst einen ersten groben Eindruck gewinnen – z. B. mit Browser-Plugins wie WAVE, Axe oder Lighthouse. Diese finden offensichtliche Fehler. Eine fundierte Bestandsanalyse erfordert aber immer den oben beschriebenen detaillierten Prozess mit Expert*innen.
Typischer Ablauf eines Accessibility-Audits (Quelle: netspirits): 1. Automatisierter Tool-Check, 2. Manueller Experten-Review, 3. Detaillierter Ergebnis-Report, 4. Maßnahmekatalog mit Empfehlungen, 5. Fortlaufendes Monitoring.
Ein solcher Audit-Prozess nimmt – abhängig vom Umfang der Website – einige Tage bis wenige Wochen in Anspruch. Kleinere Webseiten können in wenigen Tagen geprüft werden, bei sehr umfangreichen oder komplexen Auftritten kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis alle Seiten analysiert sind und der Bericht fertiggestellt ist. Während des Audits muss die bestehende Website nicht stillgelegt oder speziell vorbereitet werden – die Prüfer arbeiten mit dem, was online ist, es sind keine Änderungen am System während der Analyse erforderlich.
Prüfkriterien und häufige Barrieren
Bei einem Accessibility-Audit wird Ihre Website anhand fest definierter Prüfkriterien bewertet – in der Regel orientieren sich diese an den WCAG-Erfolgskriterien (aktuell Version 2.1, künftig 2.2) sowie einschlägigen gesetzlichen Anforderungen (in Deutschland z. B. BITV 2.0 bzw. EN 301 549). Die WCAG gliedern die Barrierefreiheit in vier Prinzipien (Perceivable, Operable, Understandable, Robust – wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust) und darunter insgesamt 50 Erfolgskriterien (WCAG 2.1, Level A und AA). Folgende Aspekte sind besonders zentral und werden bei Audits typischerweise geprüft:
Wahrnehmbarkeit von Inhalten:
Sind Texte und Bedienelemente klar erkennbar? Wichtig ist z. B. ein ausreichender Farbkontrast zwischen Schrift und Hintergrund. Ein häufiger Befund in Audits sind kontrastarme Texte, die für sehbehinderte oder farbfehlsichtige Personen schwer lesbar sind. Ebenfalls geprüft wird, ob Bilder und Grafiken Alternativtexte haben. Fehlende oder unzureichende Alt-Texte gehören zu den häufigsten Barriere-Gründen, da Nutzer*innen mit Screenreader ansonsten nicht erfahren, was auf einem Bild dargestellt ist. Auch audiovisuelle Inhalte werden begutachtet: Videos brauchen Untertitel oder Transkripte für Gehörlose, Audioinhalte gegebenenfalls Audiodeskriptionen für Blinde – fehlen diese Alternativen, stellt dies eine Barriere dar.
Bedienbarkeit und Navigation:
Ein zentrales Kriterium ist, ob die Website ohne Maus, rein per Tastatur vollständig bedienbar ist. Viele Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Screenreader-Nutzer navigieren per Tastatur – fehlt eine sichtbare Fokusmarkierung oder lassen sich bestimmte Controls (z. B. Menüs, Dropdowns) nicht per Tastatur erreichen, ergibt sich eine Barriere. Audits decken oft Probleme in der Navigationsstruktur auf: Unübersichtliche Menüs, nicht ausreichende Link-Benennungen („Hier klicken“ statt aussagekräftiger Texte) oder unlogische Übersprunglinks sind Beispiele. Auch Pop-ups und Overlays können kritisch sein, wenn sie für Assistenztechnologien nicht angekündigt sind oder sich nicht fokussieren lassen.
Verständlichkeit der Inhalte:
Hier wird geprüft, ob die Informationen und die Bedienung einfach und verständlich sind. Dazu gehört z. B. eine klare und konsistente Struktur der Überschriften, verständliche Beschriftungen bei Formularfeldern und Buttons sowie Fehlermeldungen, die den Nutzer*innen genau sagen, was schiefging und wie es zu korrigieren ist. Sprache sollte möglichst einfach sein (ggf. Leichte Sprache für wichtige Erläuterungen anbieten). Auch ob Abkürzungen erklärt werden oder ob bei mehrsprachigen Inhalten die Sprache korrekt ausgezeichnet ist, sind Punkte auf der Prüfliste.
Robustheit und Technik:
Ein oft unterschätzter Bereich ist die technische Robustheit des Frontends. Prüfer schauen hier z. B., ob das HTML valide und semantisch korrekt ist – z. B. Überschriften tatsächlich als <h1>…<h6> ausgezeichnet, Formulare mit den richtigen <label>-Zuordnungen, ARIA-Rollen nur dort wo nötig und richtig eingesetzt. Fehler in diesem Bereich können dazu führen, dass assistive Technologien die Seite nicht richtig interpretieren. So wird etwa auch bewertet, ob ARIA-Landmarken (Bereichsmarkierungen für Header, Navigation, Main Content etc.) vorhanden und sinnvoll gesetzt sind. Weiterhin wird die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Hilfsmitteln geprüft: Skaliert die Seite auf mobilen Geräten (Responsive Design)? Funktionieren grundlegende Aktionen auch mit Screenreadern oder Vergrößerungssoftware? Ein besonderes Augenmerk liegt auf Formularen: Fehlende Feldbeschriftungen, unklare Eingabehilfen oder nicht barrierefreie Captchas treten hier oft als Barrieren auf.
Bei einem gründlichen Audit wird jede festgestellte Barriere genau dokumentiert – inklusive Referenz zum entsprechenden WCAG-Kriterium oder gesetzlichen Absatz. So sehen Sie genau, welche Richtlinie nicht erfüllt wird. Die Auditergebnisse unterscheiden dabei idealerweise, ob es sich um einen harten Verstoß gegen Mindestanforderungen handelt oder um eine Best-Practice-Empfehlung zur weiteren Verbesserung.
Häufige Probleme:
Trotz wachsender Sensibilisierung sieht man in der Praxis immer wieder die gleichen Barrierefallen. Eine Auswertung von WebAIM unterstreicht dies eindrücklich: Bei einer Analyse von 1.000.000 Homepages wurden fast 50 Millionen einzelne Zugänglichkeitsprobleme gefunden – das entspricht durchschnittlich 50 Fehlern pro Seite. Zu den Top-Problemen gehören laut dieser Studie fehlende Alt-Texte, niedrige Kontraste, fehlende Formular-Labels und leere Links. Die meisten Audits bestätigen diese Häufung: Kontrast, Alternativtexte, Formularzugänglichkeit, Tastaturbedienbarkeit und Struktur sind die Bereiche, in denen am häufigsten Nachholbedarf besteht. Ein Accessibility-Audit deckt derartige Probleme systematisch auf, damit sie anschließend behoben werden können.
Audit-Report: Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
Das Ergebnis der Bestandsanalyse ist ein ausführlicher Audit-Bericht. Dieser Bericht ist von unschätzbarem Wert, denn er hält schwarz auf weiß fest, wie barrierefrei Ihre Website aktuell ist und was getan werden muss. Qualität und Aufbau des Reports können je nach Anbieter variieren – seit 2025 gibt es aber in Deutschland offizielle Empfehlungen, wie ein guter Prüfbericht auszusehen hat. Die Überwachungsstelle des Bundes (BFIT-Bund) hat Mindeststandards für Barrierefreiheits-Gutachten definiert, um die Aussagekraft und Vergleichbarkeit sicherzustellen.
Ein professioneller Audit-Report sollte insbesondere Folgendes beinhalten:
Ganz vorn im Bericht steht, was genau geprüft wurde – inklusive einer Liste der getesteten Seiten/Unterseiten, des Prüfzeitraums, der verwendeten Tools und der verantwortlichen Prüfer. So ist der Umfang klar definiert und für Dritte nachvollziehbar.
Eine management-taugliche Zusammenfassung (Executive Summary) fasst die wichtigsten Erkenntnisse in verständlicher Sprache zusammen – ohne Fachjargon, dafür mit Klartext, ob die Website die Anforderungen erfüllt oder nicht. Hier kann z. B. ein Compliance-Level angegeben sein (etwa „Erfüllt 70 % der WCAG 2.1 AA Kriterien“) und welche kritischen Probleme prioritär gelöst werden müssen.
Im Kern des Berichts steht eine strukturierte Auflistung aller gefundenen Barrieren. Zu jedem Problem sollte beschrieben sein, was nicht konform ist und warum das ein Problem darstellt – idealerweise mit Bezug auf anerkannte Normen (WCAG-Kriterium, EN 301 549 Abschnitt, etc.). Wichtig ist auch der Bezug zur Praxis: Nützlich sind Angaben, welche Nutzergruppe konkret betroffen ist (z. B. „Screenreader-Nutzer können Feld X nicht ausfüllen“) und mit welcher Hilfstechnologie dies auffiel. Bei komplexeren Befunden erhöhen Screenshots oder Code-Beispiele die Nachvollziehbarkeit.
Jeder Befund im Bericht sollte klar einer bestimmten Anforderung oder Regel zuordenbar sein. Oft wird hierzu die WCAG-Kriteriumsnummer angegeben (z. B. „Erfolgskriterium 1.1.1 Nicht-Text-Inhalte nicht erfüllt wegen fehlendem Alt-Attribut am Logo“). So sehen Entwickler sofort die Grundlage. Außerdem sollte erkennbar sein, ob es sich um einen harten Verstoß (non-compliance) handelt oder um eine freiwillige Empfehlung zur Verbesserung (z. B. „Übersetzung in Gebärdensprache wäre ein Plus, aber nicht zwingend vorgeschrieben“).
Ein hervorragender Audit-Bericht begnügt sich nicht mit der Feststellung von Fehlern, sondern liefert Lösungsvorschläge gleich mit. Zu jedem Problem sollten Maßnahmen empfohlen werden, wie dieses zu beheben ist – etwa „Fügen Sie für Bild X einen aussagekräftigen Alt-Text hinzu“ oder „Ermöglichen Sie das Schließen des Pop-ups per Escape-Taste“. Diese Empfehlungen müssen umsetzbar und verständlich formuliert sein, idealerweise direkt adressiert an Entwickler oder Designer (technische und gestalterische Hinweise). Oft wird ein Maßnahmenkatalog Teil des Berichts oder separat angefügt, der alle To-Dos aufzählt. Netspirits z. B. erwähnt, dass ihr Bericht klare, umsetzbare Handlungsempfehlungen enthält sowie eine Datei, die alle betroffenen Elemente/Seiten aufzählt, um die Bearbeitung zu erleichtern.
Da man nicht immer alles auf einmal beheben kann, sollte der Report deutlich machen, welche Probleme zuerst angegangen werden sollten. Eine Einteilung in z. B. „kritisch“, „mittel“, „gering“ oder eine numerische Priorität hilft Ihrem Team bei der Planung. Gegebenenfalls können auch Hinweise zum geschätzten Aufwand oder zur technischen Komplexität dabei stehen (so lässt sich abwägen, ob man externe Hilfe benötigt).
Nicht zuletzt sollte der Bericht selbst vorbildlich barrierefrei sein. Die BFIT-Bund empfiehlt, Gutachten in barrierefreien Formaten bereitzustellen – etwa als PDF/UA (PDF mit Universellem Design) oder als alternativ abrufbare HTML-Version. Dies garantiert, dass auch Kunden mit Behinderung den Bericht lesen können. Zudem können maschinenlesbare Versionen (z. B. strukturierte Daten als CSV/XML) hilfreich sein, um die Ergebnisse in Ticket-Systeme oder Nachverfolgungs-Tools zu importieren.
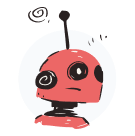
Wenn Sie einen Audit beauftragen, können Sie an der Qualität des Berichts erkennen, wie ernst es der Anbieter meint.
Leider gab es in der Vergangenheit auch „Alibi-Audits“, die nur einen automatischen Tool-Output oder eine unkommentierte Checkliste lieferten. Achten Sie darauf, dass Ihr Audit die oben genannten Kriterien erfüllt – nur dann haben Sie einen echten Mehrwert. Dank der neuen BFIT-Handreichung „Qualitätskriterien für die Begutachtung der Barrierefreiheit“ gibt es jetzt einen Maßstab, an dem Sie sich orientieren können. Ein gutes Gutachten liefert nachvollziehbare, belastbare Aussagen und einen klaren Fahrplan für die nächsten Schritte.
Nach dem Audit: Beseitigung der Barrieren und Nachkontrolle
Auf den Audit folgt die eigentliche Arbeit: die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Der Audit-Bericht dient hier als To-Do-Liste. Je nach interner Aufstellung können Ihre Entwickler und Designer die Aufgaben selbst abarbeiten, oder Sie ziehen spezialisierte Agenturen hinzu. Viele Agenturen für Barrierefreiheit bieten an, auf Basis des Audits einen Maßnahmenplan zu erstellen und sogar die konkrete Umsetzung zu übernehmen. So oder so sollten die folgenden Schritte erfolgen:
Ursachenanalyse & Lösungsentwurf:
Für jede identifizierte Barriere wird geschaut, warum sie besteht und wie man sie behebt. Oft sind es Code-Anpassungen: z. B. fehlende alt-Attribute ergänzen, ARIA-Rollen korrigieren, Formular-Markup ändern, Kontraste im CSS erhöhen etc.. Manche Probleme erfordern Designänderungen (Farbschema, Button-Größen) oder auch konzeptionelle Anpassungen (z. B. alternatives Captcha-Verfahren). In dieser Phase kann es hilfreich sein, wenn die Audit-Experten bei der Interpretation helfen – viele bieten eine begleitende Beratung an, um Ihrem Entwicklerteam die richtigen Lösungswege aufzuzeigen.
Umsetzung der Maßnahmen:
Nun werden die geplanten Änderungen umgesetzt – im Code, im CMS oder Shop-System, im Design-Styleguide etc. Dieser Schritt sollte idealerweise iterativ erfolgen: Lösen Sie zunächst die kritischsten Probleme (Prioritäten beachten!) und rollen Sie Verbesserungen ggf. schrittweise aus. Bei größeren Websites kann es sinnvoll sein, in Sprints zu arbeiten, die jeweils einen Bereich barrierefrei machen. Viele Verbesserungen, wie semantisch korrektes HTML oder bessere Tastaturbedienbarkeit, lassen sich ohne negative Auswirkungen auf die Optik oder User Experience umsetzen – im Gegenteil, oft merkt der durchschnittliche User nichts außer dass „irgendwie alles reibungsloser funktioniert“. Wichtig ist, dass während der Umsetzung nicht neue Barrieren geschaffen werden – Entwickler sollten also sorgfältig testen, ob die Änderungen die gewünschten Effekte haben und keine anderen Funktionen beeinträchtigen.
Qualitätssicherung & Re-Audit:
Nach Abschluss der Korrekturen empfiehlt es sich dringend, eine erneute Prüfung durchzuführen. Diese muss nicht so umfangreich sein wie der initiale Audit, sollte aber überprüfen, ob alle im Bericht aufgeführten Probleme tatsächlich behoben wurden. Meist wird der ursprüngliche Auditor hier noch einmal aktiv: Gute Agenturen bieten an, eine Nachkontrolle bzw. einen zweiten Durchlauf zu machen, um die Umsetzung zu verifizieren. Dadurch stellt man sicher, dass nun alle zuvor gefundenen Barrieren geschlossen sind und nicht versehentlich neue entstanden sind (Regressionstest). Zudem können bei dieser Nachprüfung ggf. Restmängel identifiziert werden, die im ersten Audit übersehen wurden. Im Optimalfall bestätigt der Re-Test, dass Ihre Website jetzt den angestrebten Konformitätsniveau entspricht – sei es WCAG 2.1 AA oder die Kriterien des BFSG. Diese Phase ist enorm wichtig für die Nachhaltigkeit: sie garantiert, dass die investierte Arbeit auch wirklich zum Ziel geführt hat.
Barrierefreiheitserklärung erstellen:
Sobald Ihre Website weitgehend barrierefrei ist, verlangt der Gesetzgeber (für öffentliche Stellen schon länger, künftig auch für viele private Anbieter) eine offizielle Erklärung zur Barrierefreiheit auf der Website. Darin legen Sie transparent dar, inwieweit Ihre Site den Anforderungen entspricht, welche Teile evtl. noch nicht barrierefrei sind und wie Nutzer ggf. bestehende Barrieren melden können. Viele Agenturen helfen bei der Erstellung dieser Erklärung als letztem Schritt des Projekts. Wichtig ist, hierin realistische Ziele zu formulieren – niemand erwartet Perfektion ab Tag X, aber Sie sollten Ihr fortlaufendes Engagement dokumentieren. Ebenso muss ein Feedback-Mechanismus angegeben sein (z. B. eine Kontakt-E-Mail oder Formular für Hinweise zur Barrierefreiheit), und Sie sollten sicherstellen, dass eingehende Meldungen ernst genommen und für die kontinuierliche Verbesserung genutzt werden. Die Barrierefreiheitserklärung wird idealerweise laufend aktualisiert, sobald weitere Verbesserungen umgesetzt sind.
Kontinuierliche Verbesserung:
Barrierefreiheit ist kein einmaliges Projekt, sondern ein dauerhafter Prozess. Webangebote entwickeln sich weiter – es kommen neue Inhalte, Funktionen oder ein Relaunch. Daher ist es sinnvoll, Barrierefreiheit im Auge zu behalten: Führen Sie regelmäßige Audits bzw. Überprüfungen durch, gerade nach größeren Updates oder Redesigns. Auch neue Standards (wie WCAG 2.2) oder Erkenntnisse können zukünftige Anpassungen nötig machen. Indem Sie Barrierefreiheit in Ihren Qualitätsprozess integrieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Website dauerhaft inklusiv bleibt und nicht wieder an Zugänglichkeit verliert. Manche Unternehmen richten ein fortlaufendes Monitoring ein – teils durch automatisierte Scan-Tools im Hintergrund – um neue Probleme frühzeitig zu erkennen.
Zuletzt sei betont: Scheuen Sie sich nicht, Hilfe von Expertinnen anzunehmen.* Die Anforderungen der digitalen Barrierefreiheit können komplex sein, doch es gibt spezialisierte Agenturen (gerade im DACH-Raum), die über langjährige Erfahrung in diesem Feld verfügen. Diese können Sie beraten, schulen und technisch unterstützen – von der Erstberatung über das Audit bis zur vollständigen Umsetzung. Oft arbeiten interdisziplinäre Teams aus Entwicklern, Designern und Accessibility-Consultants zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Website zu finden. Mit dem richtigen Partner und einem gründlichen Audit als Ausgangspunkt ist Ihr Projekt “barrierefreie Website” auf einem guten Weg, erfolgreich und fristgerecht umgesetzt zu werden.
Was kostet ein Accessibility-Audit? (Einordnung)
InboundLabs bietet den Full Accessibility Audit derzeit (Stand: Juni 2025) zum Pauschalpreis von 480 € für Standard-Websites an – dies entspricht 50 % Rabatt auf den späteren Regelsatz von 960 € (gültig ab dem 28. Juni 2025, dem Stichtag der neuen gesetzlichen Vorgaben). Der Preis deckt den vollständigen oben beschriebenen Ablauf ab: automatisierte und manuelle Tests, Nutzerfluss-Checks mit Screenreadern, Responsive-Review und Dokumentenprüfung. Bei besonders umfangreichen oder komplexen Auftritten erfolgt die Abrechnung nach Aufwand (zum regulären Stundensatz). So erhalten Sie immer ein faires, skalierbares Angebot – und zugleich Planungssicherheit für die nächsten Schritte.
Wichtig ist, den Wert eines Audits zu sehen: Es handelt sich um eine einmalige Investition, die Ihnen einen klaren Maßnahmenplan liefert und Sie vor kostspieligen Rechtsrisiken schützt. Zudem können Sie anschließend gezielt Ressourcen für die Behebung der Barrieren einplanen. Viele Anbieter schnüren auch Pakete, z. B. einen Quick-Check kostenlos und darauf aufbauend ein vertieftes Audit, oder Rabatte in Kombination mit Schulungen. Holen Sie im Zweifel mehrere Angebote ein und vergleichen Sie, achten Sie aber stets auf die oben beschriebenen Qualitätsmerkmale eines guten Audits.
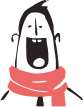
Zusammenfassung: Ein Accessibility-Audit ist der erste Schritt auf dem Weg zur barrierefreien Website.
Er verschafft Ihnen Klarheit über den Ist-Zustand und liefert einen konkreten Fahrplan, um digitale Barrieren abzubauen. Angesichts der baldigen gesetzlichen Vorgaben und der zahlreichen Vorteile von Barrierefreiheit – von größerer Zielgruppe bis besserer UX – sollte ein Audit nicht aufgeschoben werden. Vielmehr gilt: Je früher Sie starten, desto mehr Puffer haben Sie bis 2025 und desto eher profitieren Ihre Nutzer*innen von den Verbesserungen. Nutzen Sie die Bestandsanalyse also als Chance, Ihre Website zukunftssicher, nutzerfreundlich und inklusiv aufzustellen – zum Nutzen aller.